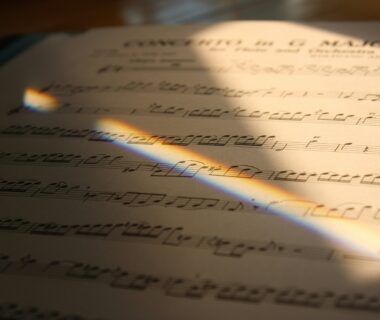Der Übergang in den Ruhestand eröffnet die Chance, neue Bewegungsroutinen zu etablieren und die Gesundheit zu fördern. Regelmässige körperliche Aktivität stärkt nicht nur die körperliche Fitness, sondern verbessert auch das seelische Wohlbefinden und die Lebensqualität. Es gibt vielfältige Wege, aktiv zu bleiben: Entscheidend ist, eine passende Aktivität zu finden und Bewegung in den Alltag zu integrieren.
Der Übergang in den Ruhestand bringt Veränderungen im Alltag und bietet die Chance, körperlich aktiver zu werden. Doch wer nutzt diese Gelegenheit tatsächlich? Dieser Beitrag – unterstützt durch die interdepartementale AGe+-Förderung der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) – beleuchtet, warum Bewegung nach der Pensionierung so wichtig ist, welche Hürden es gibt – und wie sich neue Routinen erfolgreich etablieren lassen.
Mit der Pensionierung beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Der Terminkalender wird leerer, der Arbeitsweg entfällt, und oft eröffnet sich ein Freiraum, den viele als befreiend empfinden. So bietet der Ruhestand eine gute Möglichkeit, wieder aktiver zu werden.
Warum gerade jetzt Bewegung wichtig ist
Bewegung im Alter reduziert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, fördert die Beweglichkeit, beugt Stürzen vor, stärkt die Immunabwehr und wirkt sich positiv auf die Stimmung aus. Zudem unterstützt Bewegung die soziale Teilhabe, sei es beim gemeinsamen Spazieren, im Verein oder in Kursen, und steigert die Lebensqualität. Der Übergang in den Ruhestand fällt häufig in eine Lebensphase, in der viele Menschen nach wie vor körperlich fit und gesund sind – ideale Voraussetzungen, um neue Bewegungsgewohnheiten zu etablieren oder bestehende zu festigen.
Unterschiedliche Wege – unterschiedliche Muster
Nicht alle Menschen reagieren gleich auf die neue Lebenssituation. Einige legen sofort los – mit Wandern, Velofahren oder Yoga. Andere geniessen zunächst die Ruhe, verschieben ihre Pläne auf später oder fühlen sich durch gesundheitliche Beschwerden gebremst. Auch die Art und Weise des Übergangs – ob schrittweise über Teilzeitarbeit oder abrupt – kann beeinflussen, ob und wie Bewegung in den Alltag integriert wird.
Hürden erkennen – und überwinden
Nicht allen älteren Personen fällt es gleich leicht, körperlich aktiv zu sein. Wer etwa früher im Beruf körperlich stark gefordert war, empfindet Bewegung im Ruhestand eher als Belastung. Neben körperlichen Einschränkungen können auch finanzielle Faktoren den (Wieder-)Einstieg erschweren. Andere haben den Kontakt zu bisherigen Trainingspartner*innen verloren oder fühlen sich in klassischen Sportkursen nicht wohl. Wichtig dabei: Bewegung muss nicht sportlich sein. Spaziergänge, Gartenarbeit oder Spielen mit den Enkelkindern zählen genauso – Hauptsache, man bleibt in Bewegung.
Neue Routinen, neue Perspektiven
Viele nutzen die neu gewonnene Freiheit im Ruhestand, um neue Gewohnheiten zu entwickeln und alte Verhaltensmuster zu überdenken. Wer den Ruhestand als Chance für einen Neuanfang begreift, ist besonders offen für neue Aktivitäten. Bewegung kann dabei helfen, eine neue Tagesstruktur zu entwickeln, soziale Kontakte zu pflegen und Sinn zu erleben – etwa durch gemeinsame Gruppenangebote, freiwilliges Engagement oder generationenübergreifende Projekte (z. B. «Hopp-la: Generationen in Bewegung» oder «Generationsübergreifende Begegnung und Bewegung auf dem Sulzer-Areal»).
Vieles hängt davon ab, welche persönliche Bedeutung der Bewegung zugeschreiben wird: Für manche ist sie ein Mittel zur Gesundheitsvorsorge, für andere eine Form der Selbstwirksamkeit – oder ein Weg, mit belastenden Lebensereignissen umzugehen. Auch Verluste – etwa durch Krankheit oder Tod von Angehörigen – können dazu führen, dass Bewegung als stabilisierende Ressource wahrgenommen wird.
Was hilft, um aktiv zu werden oder aktiv zu bleiben?
Eine passende Aktivität finden: Was Personen antreibt und motiviert, ist sehr individuell – soziale Kontakte, Gesundheit oder die Alltagsmobilität zu erhalten. Entsprechend vielfältig sind auch mögliche passende Sport- und Bewegungsaktivitäten. Beispielsweise können gezielt Bewegungs- und Sportberatungen genutzt werden:
- Pas à Pas+: Conseil en activité physique
- Matchmaker: Bewegungsberatung im Quartier
- Welcher Sport passt zu mir? – Differenzielle Sportberatung im höheren Erwachsenenalter
Beim Finden einer passenden Aktivität sollte u.a. auf Folgendes geachtet werden:
- Anknüpfen an Gewohntes: Wer früher gerne Rad gefahren ist, sollte dort wieder ansetzen.
- Neues ausprobieren und reflektieren: Falls noch unklar ist, welche Aktivitäten passend sind, können auch neue Aktivitäten ausprobiert und anschliessend reflektiert werden, welche Aspekte der Aktivitäten besonders gefallen haben oder weniger ansprechen. So bieten beispielsweise die Pro Senectute, die Volkshochschule, die Rheuma-Liga oder auch Sportämter, z. B. die Stadt Winterthur, zahlreiche Angebote an.
- Freude und Kompetenzerleben statt Pflichtgefühl: Ein gutes Befinden während der Aktivität und Kompetenzerleben sind zentral für die langfristige Aufrechterhaltung des Verhaltens. Im Vordergrund sollte daher nicht allein der gesundheitliche Nutzen einer Aktivität stehen, sondern auch die Freude an der Bewegung und die Passung zur Person.
Bewegung in den Alltag integrieren: Es muss nicht gleich ein Sportprogramm sein – auch Gartenarbeit oder Treppensteigen zählen. Auch kleine, abwechslungsreiche Übungen im Alltag können dazu beitragen, aktiver zu sein.
Kleine Ziele und Zwischenziele setzen: Jede Bewegung zählt! Auch bereits 10 Minuten moderate Bewegung bringen gesundheitliche Vorteile. Eine schrittweise Steigerung des Umfangs, gefolgt von einer Erhöhung der Intensität, ist dabei sinnvoll.
Gemeinsam loslegen: Mit Familienmitgliedern, Freund*innen oder in Gruppen ist der Einstieg häufig leichter.
Fazit: Ruhestand – der richtige Zeitpunkt für mehr Bewegung
Der Übergang in den Ruhestand ist nicht nur ein biografischer Wendepunkt, sondern auch eine wertvolle Gelegenheit zur Neugestaltung. Mit mehr freier Zeit eröffnet sich die Möglichkeit, sich selbst und die eigene Gesundheit stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Wer diese Phase bewusst nutzt, kann neue Bewegungsroutinen aufbauen, bestehende stärken und so Körper und Geist fördern. Bewegung wird damit zum Schlüssel für mehr Lebensqualität – und hilft, den neuen Lebensabschnitt aktiv und erfüllt zu gestalten. Die Vielfalt der Wege, die Menschen in dieser Lebensphase wählen, zeigt: Es gibt kein richtig oder falsch – nur viele gute Gründe, aktiv zu werden.